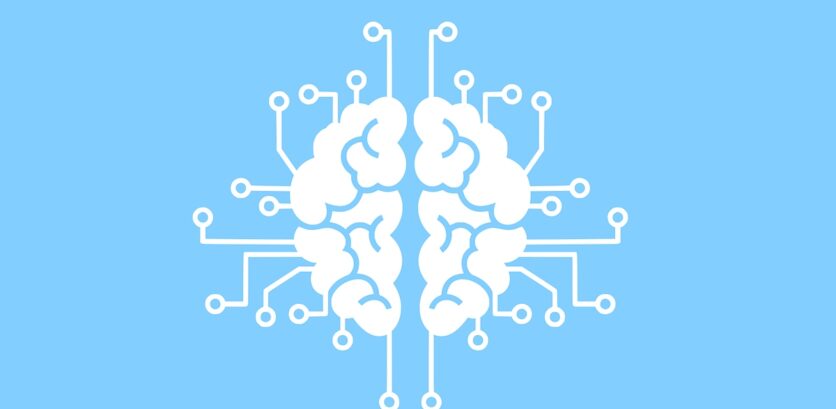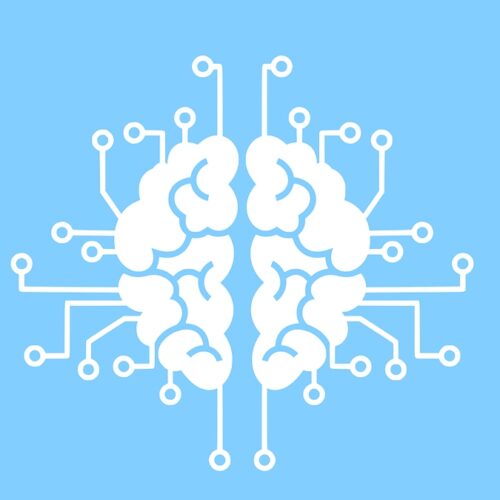Angesichts des unaufhaltsamen Voranschreitens Künstlicher Intelligenz wird eines immer deutlicher: KI wird den Arbeitsmarkt, die Kreativbranche und die Kunst revolutionieren. Doch dieser Ausblick ruft nicht nur positive Reaktionen hervor. Besonders das Lager derjenigen, die ihren Lebensunterhalt mit kreativer Arbeit verdienen, spaltet sich. Während die einen die KI als wertvolles Tool ansehen, fürchten die anderen, eines Tages von ihr ersetzt zu werden. Doch ist diese Sorge berechtigt? Könnte uns eine Maschine wirklich eines Tages unsere Kreativität streitig machen?
Ein Beitrag von Valentina, Juniortexterin in Berlin
Die Frage, ob KI langfristig ein nützliches Werkzeug bleibt oder ob sie irgendwann die Autor*innenschaft übernimmt, ist nicht neu. Dieser Diskurs wurde schon zu Zeiten geführt, als die KI noch in den Kinderschuhen steckte. So äußerte sich der amerikanische Forscher Marvin Minsky, der den Begriff Künstliche Intelligenz im Jahr 1956 auf der Dartmouth Conference begründete, eher skeptisch zu dem Thema: „Once the computers got control, we might never get it back. We would survive at their sufferance. If we’re lucky, they might decide to keep us as pets.” Auch wenn die meisten KI-Expert*innen die Sache heutzutage nicht mehr ganz so zynisch betrachten, kennen viele Laien das Phänomen: Sicherheitshalber ist man dann doch lieber netter zur KI, als es sein müsste… Denn man weiß ja schließlich nie.
Doch abgesehen davon, ob uns die KI – im Falle einer dystopischen Machtübernahme in ferner Zukunft – wohlgesonnen ist oder nicht, wie steht es um ihre kreativen Fähigkeiten? Als direktes Resultat unserer Fähigkeit, Emotionen zu fühlen, wird die Kreativität häufig als die letzte Bastion der menschlichen Einzigartigkeit und demnach als unmöglich zu imitieren angesehen. Dennoch sehen wir mittlerweile unzählige Kunstwerke, die nicht von Menschenhand, sondern von einer KI geschaffen wurden. Künstliche Intelligenz verzeichnet Gewinne bei komplexen Brettspielen wie Go oder Schach, sie malt Bilder, schreibt Gedichte und komponiert Musikstücke, die nicht weniger ins Mark gehen als die ihrer menschlichen Kolleg*innen. Und wenn man diese Dinge nicht Kunst nennen möchte, womit haben wir es dann zu tun? Wenn wir der KI angesichts solcher Errungenschaften einen Anspruch auf Kreativität versagen wollen, müssen wir uns wohl an dieser Stelle die Frage stellen, was Kreativität überhaupt ist.
Auf den Spuren der Kreativität – so fing alles an
Lange Zeit wurde Kreativität von der Psychologie ignoriert und eher als ein besonderes Phänomen im Geiste herausragender Individuen angesehen, statt sie im Kontext kognitiver Prozesse zu verorten. Es herrschte ein Hochbegabten-Paradigma, das sich besonders im Geniekult um Künstler wie Goethe und Schiller hervortat. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden solche Vorstellungen von Kreativität und Talent, die soziale sowie psychologische Einflüsse auf künstlerischen Output vollkommen außenvorlassen, jedoch nach und nach verworfen und im Kontext der Intelligenzforschung durch ein breiteres Verständnis von Kreativität ersetzt. Joy P. Guilford, einer der leitenden Köpfe auf dem Gebiet, brach schließlich vollständig mit den alten Konventionen, indem er Kreativität als eine Eigenschaft beschrieb, die jedem einzelnen Menschen zu eigen ist. Mit den Jahrzehnten vermehrten sich die Einblicke und langsam aber sicher wurden wissenschaftliche Einordnungen, Unterscheidungen und Definitionen gefunden.
So lassen sich Denkvorgänge nach Guilford in zwei Rubriken unterteilen. Auf der einen Seite steht das sogenannte konvergente Denken, ein strikt logisches Vorgehen, das auf einen ganz bestimmten Lösungspunkt hinführt. Unter divergentem Denken wiederum versteht man einen kreativen Denkprozess, die Verknüpfung unüblicher Assoziationen und den Wechsel von Perspektiven, was den eigenen mentalen Horizont erweitert. Die Ergiebigkeit des divergenten Denkens hängt von verschiedenen Eigenschaften ab. Es verlangt von Denkenden ein gewisses Maß an Problemsensitivität, also die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und zu verorten. Eine weitere nötige Eigenschaft ist eine hoch ausgeprägte Ideenflüssigkeit, mit der die Anzahl der Ideen beschrieben wird, die wir in kurzer Zeit hervorbringen können. Auch die mentale Flexibilität gehört dazu, da sie uns ermöglicht, neue Sichtweisen zu entwickeln und etablierte Konzepte auch mal ganz beiseitezulassen. Zuletzt sind die Fähigkeit zur Elaboration – der Anpassung unserer Ideen an die Realität – und zur Originalität von entscheidender Bedeutung. Besonders dann, wenn es um die Umsetzung kreativer Ideen in ein kreatives Produkt geht.
In seinen Forschungen konnte Guilford dieses divergente Denken und die dazugehörigen kreativen Gedankenströme häufig an den Grenzstellen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Domänen verorten anstatt in deren Kern, da hier kognitive Strömungen verschiedene Gebiete miteinander verknüpfen und so die auf einem Gebiet geltenden Konventionen brechen und neu verbinden. Diese Art der mentalen Akrobatik ist ein großer Teil dessen, was Kreativität im Allgemeinen ausmacht.
Welche Arten von Kreativität gibt es?
In den darauffolgenden Jahren, in denen sich die Psychologie immer mehr mit dem Phänomen der Kreativität befasste, wurde deutlich, dass nicht einfach nur von einer einzigen Kreativität gesprochen werden kann. Denn ebenso wie die Köpfe, in denen sie entsteht, hat auch die Kreativität selbst viele Gesichter.
So unterscheiden manche die Kreativität hinsichtlich dessen, was sie erreichen möchte. Besteht das Ziel etwa darin, eine vorgegebene Aufgabe zu lösen, wird von „normativer“ oder problemlösender Kreativität gesprochen. Soll aber etwas Neues entworfen oder eine bisher nicht-existente Möglichkeit erkundet werden, nennt man dies „erforschende“ oder auch schöpferische Kreativität.
Häufig ist auch von Big C und Small c die Rede, also von der großen und der kleinen Kreativität. Big C steht für die Art von Kreativität, die wir von den typischen Genies der Kunstgeschichte kennen. Ob Goethe, Michelangelo oder Madonna – manche Menschen schaffen es, eine große Zahl an Menschen mit ihrer kreativen Arbeit tiefgreifend zu berühren. Hier ist das kreative Produkt also etwas, das neu ist, überrascht und gleichzeitig von einem solchen qualitativen Wert ist, dass es unsere Emotionen beeinflusst. Es bringt uns dazu, die Welt – wenn auch nur im Kleinen – auf eine andere Art und Weise zu betrachten, als wir es bis dahin getan haben. Häufig denken wir beim Thema Kreativität an solche weltverändernden Künstler*innen. Dabei sind diese bahnbrechenden, kreativen Durchbrüche relativ selten.
Seltener jedenfalls als die Small c, die Alltagskreativität. Hierbei handelt es sich um den Motor der kleinen Ideen, der kleinen Aha-Momente, die unser Leben gleichsam durchwirken wie bereichern. Denn diese Kreativität ist nicht das Alleinstellungsmerkmal großer Figuren der Menschheitsgeschichte, sondern ist in jeder*jedem von uns zuhause. Sie zeigt sich, wenn wir eine neue Zutat zum Rezept hinzufügen und das Gericht auf einmal doppelt so gut schmeckt. Wenn wir unserem Hund einen neuen Trick beibringen, die Blumen im Garten in einem neuen Muster ansähen, Bilder an unsere Wand hängen oder einige Gedanken ins Tagebuch kritzeln. Zwar bringen uns diese Dinge weder Ruhm noch Reichtum, sie sind dennoch eine Form des kreativen Denkens. Und dabei keineswegs unbedeutend.
Unser Kopf rekombiniert hier aus dem Raum der uns bekannten Möglichkeiten und bei festgelegten Regeln – denn selbst die*der Kreativste unter uns würde wohl kaum Kerzenwachs in die Suppe geben – und schafft so neue Varianten von bereits Dagewesenem. Diese Art der Rekombinierenden Kreativität ist etwas, bei dem uns die KI ideal zur Seite stehen kann. Denn auch sie macht ja eigentlich nichts anderes, als aus einem festgelegten Datenset neue Ideen zusammenzubasteln. Anders sieht es aber bei der Transformativen Kreativität aus, bei der wir mental so flexibel sein müssen, dass wir alte Regeln brechen und etwas komplett Neues erschaffen. Ein Beispiel hierfür ist Pablo Picasso und der von ihm ins Leben gerufene Kubismus, der herkömmliche Regeln der Malerei für sich nutzt aber völlig neu verwendet. Damit würde sich ein Rechner – bisher – noch recht schwertun. Aber was genau bewegt uns eigentlich dazu, den Rahmen des stringenten Überlegens zu verlassen und uns in bisher unbekanntes Terrain vorzuwagen?
Was der menschlichen Kreativität zugrunde liegt
Um die mentalen Dimensionen des kreativen Prozesses nachzuzeichnen, lohnt es sich, erst einmal nach den Voraussetzungen kreativen Denkens zu fragen. Und was nun folgt, wird bestimmt einige Kreative unter uns erleichtern. Denn wenn sich Kreativitätsforscher*innen bei einer Sache sicher sind, dann hierbei: In der Ruhe liegt die Kraft. Unser Unterbewusstsein und die dort verorteten Verarbeitungsvorgänge sind die größte Quelle der Kreativität. Hier werden Erinnerungen und Assoziationen neu verknüpft und all das passiert erst dann so richtig, wenn wir einfach mal nichts tun. Soweit das eben möglich ist, denn Nichtstun ist für unser Gehirn sowieso nahezu unmöglich. Selbst beim Herumliegen und Wand-Anstarren, beim an der Ampel stehen oder Daumendrehen werden in unseren Köpfen ununterbrochen Gedankenketten geknüpft. Diese Ruhenetzwerke, die wir beim Tagträumen am allerbesten zu spüren bekommen, sind eine enorm wichtige Grundvoraussetzung für unser kombinatorisches Denken.
Erst wenn diese Basis einmal gelegt ist, kann alles Weitere entstehen. Kreativität findet in einem Verhältnis von Struktur und Chaos statt, es bewegt sich in einem Wechselspiel von Schöpfung und Zerstörung. Nachdem in unseren Köpfen solche Strukturen während Ruhephasen und in Form neuronaler Netzwerke zustande gekommen und fixiert worden sind, können sie nämlich durch freie Fantasiebildung auch wieder aufgelöst oder mit anderen Hirnarealen verbunden werden. Praktisch gesagt: Kreative Arbeit ist eine Gradwanderung zwischen strukturiertem, diszipliniertem Arbeiten und völlig freiem, losgelöstem Denken. Und letzteres funktioniert am allerbesten ohne Zeitdruck, Erwartungen oder vorgegebenen Rahmen.
Die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, ist also eine Grundvoraussetzung, damit unser Gehirn sein kreatives Potenzial entfalten kann. Doch wenn es um die kreative Person an sich geht, spielen noch weitere Aspekte eine Rolle. Psycholog:innen sprechen von fünf Grundvoraussetzung:
- Begabung: Zwar wurde der Geniekult in der modernen Wissenschaft längst hinter sich gelassen, ein gewisser Grad an künstlerischer Begabung ist aber trotzdem eine wichtige Voraussetzung.
- Wissen und Können: Hier geht es weniger um naturgegebene Fähigkeiten, als um erlernte Fakten und Methoden. Besonders für die Kunstproduktion braucht es gewisse Techniken, ein bestimmtes Hintergrundwissen und bisweilen auch physisches Training. Das Komponieren eines Musikstückes wäre ohne diese Dinge beispielweise unmöglich.
- Motivation und Disziplin: Übung macht die Meisterin. Und auch Kreativität lässt sich durch genug Disziplin trainieren. Die Motivation zur Kreativität kann sogar wichtiger sein als eine natürliche Begabung.
- Persönlichkeit: Kreative Menschen weisen häufig ähnliche Charaktermerkmale auf. Ausdauer, Hartnäckigkeit, Spontanität und Neugier werden häufig genannt.
- Umgebungsbedingungen: Doch selbst wenn all diese Dinge aufeinandertreffen, heißt das noch lange nicht, dass einem der kreative Durchbruch in den Schoß fällt. Die Umgebungsbedingungen spielen eine enorm große Rolle dabei. Kreativität hat somit auch immer eine soziale Dimension, da sie Zeit und Raum benötigt, den sich nicht alle Menschen so einfach leisten können.
Besonders die Motivation zur Kreativität ist ein Aspekt, den wir uns im Kontext des kreativen Potentials künstlicher Intelligenz genauer ansehen sollten. Was motiviert einen Menschen dazu, ein Bild zu malen, einen Roman zu schreiben oder eine Symphonie zu komponieren? Der Antrieb hierfür ist in unseren Emotionen zu finden. Wir machen Kunst, um uns zu trösten, um innere Verwirrungen zu lösen oder um unseren Sehnsüchten Ausdruck zu verleihen. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen, das gehört werden will. Wir sehnen uns danach, in unseren Gefühlen verstanden und gesehen zu werden und nutzen unsere Kreativität als Ausdrucksmöglichkeit, als Sendeinstrument, wenn man so will. Art und Ausmaß unserer kreativen Produktion hängen häufig von dieser sogenannten intrinsischen Motivation ab, die (bisher) allein uns Menschen vorbehalten ist. Sie ist die Art von Motivation, die wir spüren, wenn wir an einer Sache primär um ihrer selbst Willen arbeiten. Weil uns die Arbeit Freude und Befriedigung bereitet. Auch das Individualitäts- und Erfolgsstreben eines Menschen kann eine intrinsische Motivation zur künstlerischen Produktion darstellen. Besonders in westlichen Kulturen wünschen sich Menschen häufig Anerkennung, sie wollen sich von der Masse abheben, hervorstechen, unvergesslich bleiben und nicht selten mit ihren eigenen Ideen die Welt verändern. In einer Welt, die sich immer schneller und schneller zu drehen scheint, streben wir danach, unseren Fußabdruck zu hinterlassen. Intrinsische Motivation ist bei weitem förderlicher für Kreativität als externe Motivationen. Wenn wir Dinge nur tun, weil sie uns aufgetragen wurden, ist das Ergebnis meistens nicht gerade außergewöhnlich. Weil es uns auch irgendwie einfach egal ist. Bisher scheinen KI-Chatbots wie ChatGPT zumindest dieses Gefühl gut zu kennen…
Emotionen können also als primäre Motivatoren förderlich für die Kreativität sein, doch haben sie bisweilen auch einen gegenteiligen Effekt. Denn in unserem Gehirn ist für die Entstehung kreativer Gedanken eine offene, ungehemmte Aufmerksamkeit entscheidend, mit deren Hilfe wir aus der gesamten Fülle der uns zur Verfügung stehenden Informationen schöpfen können. Demensprechend sind unsere Emotionen dann hinderlich, wenn sie mit einer starken Hemmung einhergehen. Das sind beispielsweise Gefühle der Angst, des Drucks oder Zustände zu starker Fokussierung, die sich dann einstellen, wenn wir versuchen, etwas durch pure Willenskraft zu erreichen. Verschiedene soziale Aspekte können ebenfalls zu Kreativitätsblockaden werden. Soziale Erwartungen und finanzielle Sorgen können zu Versagensängsten, Leistungs- und Zeitdruck, Konformitätsdruck und vielen anderen negativen Emotionen führen, die unser kreatives Denken im Keim ersticken.
Was beim Kreativsein in unseren Köpfen vor sich geht
Kreative Arbeit ist also etwas, das nicht ohne gewisse Voraussetzungen auskommt. Wir brauchen Motivation, ein forderndes Umfeld, einen „freien“ Kopf ohne Selbstzweifel oder Leistungsdruck, Disziplin, Talent, Zeit, Geld und Ruhe. Nicht immer sind diese nötigen Voraussetzungen von uns selbst beeinflussbar, doch können wir immerhin versuchen, unserem Gehirn auf die Sprünge zu helfen. Und zum Glück ist der wichtigste Faktor auch der, an dem wir am einfachsten ansetzen können: Unserem Kopf Langeweile erlauben. Zwar lassen sich Geistesblitze nicht erzwingen, doch betonen Forscher*innen immer wieder, dass sie sich meistens in einem kognitiven Ruhestadium einstellen, in dem sich das Gehirn im Leerlauf befindet und diesen Zustand gleichzeitig als befriedigend erfährt. Assoziieren ist ein Automatismus unseres Denkens, Nichtstun eine Unmöglichkeit. Und in Momenten, in denen unser Gehirn keine neuen Reize verarbeiten muss, sondern sich auf alte Eindrücke rückbezieht, entstehen ebenjene neuen Assoziationen, die wir als plötzliche Geistesblitze empfinden. Rationalität und Zwang haben mit diesen wertvollen Momenten nichts gemeinsam, sie stehen ihnen sogar im Weg.
Der Geistesblitz stellt eine der fünf Phasen dar, die das menschliche Gehirn im kreativen Prozess durchschreitet. Er beginnt mit der Vorbereitung auf ein Projekt, mit dem Zurechtlegen des benötigten Skill-Sets. Dann folgt die Inkubation, in der sich in unseren Köpfen etwas Neues zusammenbraut. Erst dann kommt der Geistesblitz in der Illuminationsphase. Bis hierhin passiert das Kreativsein noch mehr oder weniger von selbst, Forschende sprechen von etwa 2000 „originellen“ Gedanken, die uns jeden Tag durch den Kopf schießen. Die eigentliche Arbeit liegt darin, diese Gedanken zu bewerten und sie schließlich auszuarbeiten. Und auch um diese Aufgabe zu bewältigen, können wir unser Gehirn trainieren, indem wir versuchen, in allen Arbeitsschritten eine Balance zwischen divergentem und konvergentem Denken zu finden. Künstler*innen und Kreative kennen diese Balance. Viele benötigen ein gewisses Maß an Struktur, das aber nicht die Überhand gewinnen darf. Um dies zu vermeiden, kann es helfen, für räumliche Abwechslung zu sorgen, sich Ruhepausen und Denkzeiten einzuräumen und auf die innere Stimme zu hören. Außerdem ist es wichtig, die eigene kreative Arbeitsweise zu kennen und sich an sie zu halten. Zu welcher Uhrzeit bin ich am produktivsten? Was brauch ich, um zur Ruhe zu kommen? Denn das gesunde Verhältnis zur eigenen Gedankenwelt ist der wohl wichtigste Aspekt für ein fruchtbares Schaffen. Nur so kann sich ein kreativer Flow einstellen.
Was bedeutet Kreativität nun, wenn sie Künstlicher Intelligenz entspringt?
Wir Menschen sind fühlende Wesen. Und dass diese Tatsache einen massiven Einfluss auf unser Denken hat, ist nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Emotionen motivieren uns, treiben uns an, oder bewirken eben das Gegenteil und führen zu Stillstand und Resignation. Von all diesem Chaos ist die KI nicht betroffen. Zwar fehlt ihr die intrinsische Motivation, Großes zu vollbringen. Dafür sind ihr menschliche Konzepte wie Leistungsdruck aber ebenfalls fremd. Die Erfüllung all jener Voraussetzungen, die unsere sensiblen Köpfe für den kreativen Output benötigen, kann sich die KI sparen. Sie macht einfach, was man ihr sagt, wie man es ihr sagt und in der Zeit, der man ihr dafür zur Verfügung stellt.
Wenn eine KI kreativ wird, durchforstet sie Datensätze, die ihr von Menschenhand zur Verfügung gestellt wurden. Diese werden von ihr nach festgelegten Rechenregeln neu kombiniert. Hier zeigt sich bereits, dass die KI – zumindest bis jetzt – stark von menschlichem Input abhängt. Wird ihr beispielsweise die Kreation eines Gemäldes aufgetragen, orientiert sie sich an der Kunst unzähliger Menschen, auf deren Werke sie zugreifen kann. Ebenso wie menschliche Maler*innen orientiert sie sich an den großen Meister*innen der Kunstgeschichte und kombiniert bereits existierende Kunst neu. Zwar kann sie die von ihr erkannten Stile, Techniken und künstlerischen Methoden nicht wie eine menschliche Kollegin gleichzeitig für sich nutzen und ihre Regeln missachten – Beispiel Picasso und der Kubismus –, dafür kann sie aber etwas anderes: Nämlich riesige Datensätze in kürzester Zeit in sich aufnehmen und sich von ihnen „inspirieren“ lassen. Während wir ein halbes Leben dafür bräuchten, die gesamte Literatur der Romantik zu lesen, bewältigt eine KI diese Aufgabe innerhalb kürzester Zeit. Im Kontext der KI bedeutet Kreativität erst einmal die Fähigkeit einer Maschine, logisches Denken und gestalterisches Schaffen zu imitieren. Fähigkeiten, zu denen bisher nur der Mensch fähig war. Durch maschinelles Lernen kann die KI diese Fähigkeiten in Zukunft in Echtzeit verbessern und bis zu einem gewissen Punkt auch eigenständige Ergebnisse liefern. Noch befindet sich die KI im Lernprozess, doch das kann sich schnell ändern. Und fest steht bereits jetzt, dass Künstliche Intelligenz der Welt ein nie dagewesenes Level an Effizienz und Geschwindigkeit beschert.
Ob die KI nun für immer ein nützliches Werkzeug in der kreativen Arbeit bleibt oder ob sie eines Tages selbst das Ruder übernimmt, kann uns vermutlich nur die Zukunft selbst verraten. Doch sehen wir bereits heute, wie ihre Präsenz die Kreativbranche und die Kunstwelt neu gestaltet. So wird die Fähigkeit, präzise Prompts zu schreiben, ein immer wichtigerer Skill in der Arbeitswelt und besonders Grafikdesigner*innen müssen in dieser Hinsicht am Puls der Zeit bleiben, da besonders in der visuellen Kunst garantiert niemand auf die unglaublichen Möglichkeiten verzichten möchte, die KI-Programme bereits jetzt mitbringen. Ob diese Produkte nun als Kunst bezeichnet werden können oder nicht, ist eine Frage, um die sich Philosoph*innen bestimmt noch lange streiten werden. Wer hier anfängt, findet sich schnell in metaphysischen Fahrwassern wieder und mit der grundlegenden Frage danach konfrontiert, was in dieser Welt überhaupt als echt und unecht bezeichnet werden kann.
Sorgen um die besondere Stellung, die menschengemachte Kunst nach wie vor einnimmt, muss sich so schnell jedenfalls niemand machen. Kreativität ist das Werkzeug, mit dem wir unser Bewusstsein entdecken. Kunst ist etwas, das wir aus reinem Gefühl und entgegen jeder Nützlichkeit tun. Und am allerwichtigsten: Kunst steht in direktem Verhältnis zu ihren Rezipient*innen. Selbstverständlich kann es sein, dass ein Roboter eines Tages besser malen, komplexer schreiben oder schöner singen kann als wir. Doch wollen wir das? Nein. Kunst bleibt allein aus dem Grund Menschenarbeit, weil sie immer auch zwischenmenschliches Verhandeln von Bedeutung bedeutet. Wenn wir ein Bild betrachten, ein Lied hören oder ein Buch zur Hand nehmen und eine Geschichte lesen, wollen wir keine Neukombination bereits bestehender Daten vor uns haben. Wir wollen die Vision und die Gedanken eines Mitmenschen in uns aufnehmen, von ihnen lernen und durch sie fühlen, was vor uns ein*e andere*r so oder so ähnlich auch gefühlt haben könnte.